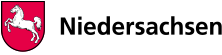Einfach loswandern
Laudatio auf Karen Duve zum Walter Kempowski-Preis für biografische Literatur von Alexander Solloch:
Liebe Karen Duve,
sehr geehrte Angehörige der Familie Kempowski,
sehr geehrter Herr Minister Mohrs,
liebe Gäste des Landes Niedersachsen,
wir können das, was Lobendes zu sagen wäre über Karen Duve im Allgemeinen und ihr literarisches Werk im Besonderen (und es wäre viel!), auch abkürzen und Wolfgang Herrndorf zitieren, der gesagt haben soll: „Karen Duve ist Gott!“ Recht apodiktisch, aber, wie immer bei Herrndorf, auch sehr gut formuliert; das können wir also mal so ausrufen, und danach sagt Karen Duve noch „danke“, und dann gehen wir alle gemeinsam ans Buffet. Da wären dann ja bestimmt interessante Beobachtungen zu machen. Wenn Karen Duve nach ihrem jüngsten Roman, „Sisi“, gefragt wurde, ob sie nicht in Ansehung all der ganzen Fuchs- und Hirschjagden, von denen sie da erzählt, all der steifen Empfänge, der hohlen Reden, des eitlen Gepränges, der stundenverschlingenden Herstellung von Frisuren, ob sie also nicht angesichts all der so recht fruchtlos dahinfließenden Tage, Monate und Jahre, in die sie sich mit äußerster Akribie hineingegraben hat, manchmal doch denken musste: Meine Güte, was für eine Ödnis und Leere im Leben der Königin und Kaiserin und der sie umschwirrenden Menschen, was für eine Zeit- und Geld- und Energieverschwendung – wenn man Karen Duve das fragte, antwortete sie: „Nee. Das habe ich nicht gedacht. Ich gucke mir Menschen immer an wie Schimpansen. Das ist einfach Schimpansentum. Es geht um Macht, um Ansehen, um Aufmerksamkeit, um viele Klicks, wer kommt als Erste in den Raum hinein, wer darf als Erster ans Buffet. Selbst bei Pavianen leitet nicht der Stärkste oder Fähigste das Rudel, sondern derjenige, der es schafft, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.“ Karen Duve zufolge ist mithin jegliches soziale Gebaren, auch das scheinbar nutzloseste, noch aufregend.
Und sie schaut darauf, schaut auf uns, wie auf Schimpansen oder Paviane. Dann hätte Wolfgang Herrndorf also recht? Karen Duve ist Gott? Daran ist mindestens so viel richtig, dass sie als Schöpferin staunenswerter Welten hingebungsvoll bewundert werden kann, und so viel falsch, dass sie, wenn man’s genauer bedenkt, korrekter doch wohl eher als Vorfinderin statt als Erfinderin unserer Welt, als Weltdeuterin und Welterzählerin anzusehen wäre, ganz abgesehen davon, dass Gott keine Literaturpreise bekommt; Karen Duve allerdings auch viel zu wenige, obwohl sie jeden Literaturpreis verdient hat und ganz besonders diesen, den Walter Kempowski-Preis für biografische Literatur.
Das verbindet sie übrigens mit dem Namenspatron dieser Auszeichnung: die – gemessen an der Bedeutung des Werks – relativ geringe Zahl an Preisen und der – an dieser Stelle natürlich nur spekulativ zu erfassende – Grund dafür: die fabelhafte Lesbarkeit ihrer Bücher, die Eingängigkeit ihrer Beobachtungen, Szenerien, Schauplätze. Es regnet viel in Karen Duves Büchern, aber es liegt kein Nebel über ihnen, der alles oder doch immerhin manches verunklart, jedenfalls kein künstlicher Nebel, den der preisevergebende Literaturbetrieb doch phasenweise so liebt. Düster und traurig und schwer sind die Geschichten, die sie erzählt; schwebend und leicht und witzig ist der Ton, mit dem sie es tut. Da sie eine Literatin ist und keine Entertainerin, handelt es sich hierbei natürlich um die Sorte Witz, die allein erträglich ist und tröstlich: jener Witz nämlich, der zeigt, dass die Dinge, so wie sie liegen, ziemlich schlimm liegen, es aber doch immerhin irgendwie weiter geht, solange sie benannt und beschrieben werden können. Anne Strelau, die Ich-Erzählerin in Karen Duves zweitem Roman „Dies ist kein Liebeslied“ (2002 erschienen) lernt schon als kleines Kind, sich herauszumogeln aus unguten Situationen, die, wie sie früh erfährt, unter allen Situationen am weitesten verbreitet sind; das Ungute als Standardsituation des Lebens. Anne Strelau entzieht sich:
Wann immer irgendetwas schiefgehen würde, konnte ich einfach krank werden. Richtig krank, ernstlich und nachweislich – nicht nur so ein bisschen Temperatur und vorgetäuschte Bauchschmerzen. Die Masern, die Röteln, Windpocken oder Scharlach konnte ich bekommen – und das allein durch Willenskraft. Ein wunderbares Leben lag vor mir. Denn wenn es mir schlecht ging, ging es mir richtig gut.
Karen Duves Humor entsteht aus der inneren Misere, die wir alle kennen. Alexandra Herwig, die jahrelang in Ermangelung anderer Ideen Taxi fährt, damit die Zeit überbrückt ist, bis sich „etwas Großes und Besonderes von selbst“ ergibt, und damit der Roman, in dem das geschieht, „Taxi“ heißen kann, stolpert nicht nur so halb zufällig in diesen Beruf, sondern auch in die Beziehung zu ihrem Kollegen Dietrich. Dass dies eine ergreifende Liebesgeschichte wäre, kann man nicht behaupten, aber weil der Mensch sich an alles gewöhnt, währt sie immerhin eine ganze Weile. Nach 200 Seiten passiert dann doch das Unausweichliche:
Dann schwiegen wir plötzlich. Ich zog Bücher aus den Regalen und schob sie wieder hinein, ohne sie anzusehen.
„Was ist los?“, fragte Dietrich.
„Es ist aus mit uns.“
„Ja“, sagte er, „ich weiß.“
Ich fing an zu weinen. Was ich Dietrich antat, war nicht wiedergutzumachen. Jemanden wie mich würde er nie wieder finden. Dietrich stand auf und holte eine Rolle Küchenpapier. Er reichte sie mir, und dann fing auch er an zu weinen.
Karen Duve ist eine Meisterin in der Kunst, völlig unerwartet kleine Pointen zu setzen; fast überliest oder überhört man sie. Manchmal, vielleicht weil in ihren Romanen so viel Musik ist, kommt mir Karen Duve vor wie eine besonders lässige Schlagzeugerin oder passender: wie eine Drummerin, die Drummerin der Dichtkunst. Natürlich beherrscht sie alle Grundrythmen aufs Vollkommenste, aber immer mal wieder, ganz plötzlich und oft nur untergründig spürbar, baut sie einen Shuffle-Groove ein, und die Worte galoppieren, oder einen Offbeat, der die Hörgewohnheiten auf die Probe stellt; geradezu synkopisch erzeugt sie Spannung. Anne Strelau in „Dies ist kein Liebeslied“ hört Musik, es ist die Zeit der Mix-Tapes auf Kassette, sie hört Musik, malt sich die Lippen an, „erst sehr hell, dann dunkel, dann doch lieber sehr hell, und ich kreiste meine Augen mit schwarzem Kajal ein. Ich sah aus, als wäre ich schön.“
Und wie im Falle von Anne ist es auch bei den Texten von Karen Duve nicht irgendwelche Schminke, die sie schön macht, sondern es ist die Musik; die Musik in Karen Duves Witz, in ihrem Humor. Anne, die, nachdem sie durch die Steuerinspektorprüfung gefallen ist und nachdem ihre Mutter die Sorge geäußert hat, wenn sie jetzt das Steuerinspektorwesen aufgebe, bestehe die Gefahr, dass der Vater sich umbringe, und nachdem sie darum den Eltern hat versichern müssen, dass sie die Steuerinspektorprüfung wiederholen werde, von allem sowieso die Nase restlos voll hat, wird zur Kurzzeit-Tramperin und wartet nun an einer Raststätte vor Kassel auf eine Mitfahrgelegenheit:
Von oben der Regen, und von der Seite spritzten mir die Autos den Straßendreck bis an die Hüften. Anfangs versuchte ich noch, den Schlammfontänen auszuweichen, aber bald triefte ich und sah so elend und so dreckig aus, dass erst recht niemand mehr anhielt. Dann kam dieser große, dunkelblaue Mercedes. Er verlangsamte, und ich hob für alle Fälle den Daumen. Der Scheibenwischer schwang zur Seite, und für eine halbe Sekunde sah ich ganz deutlich das Gesicht des Fahrers. Er starrte mich an, angewidert und empört. Als sich das Regenwasser schon wieder auf die Windschutzscheibe legte, sah ich noch, wie er den Kopf neigte und sich mit dem Finger an die Stirn tippte. Eine kalte Hand legte sich um mein Herz, und ich schwor mir, niemals CDU zu wählen.
Das allerdings hilft ihr auch nicht. Sie verliebt sich in einen Mann und liebt ihn, wie sie eigens betont, „sogar dafür, dass er in die SPD eingetreten“ ist. „Wie schade“, sinniert Anne, „dass mein Unglück nicht von der Art war, dass eine SPD-Reform es hätte lindern können.“
Kurt Tucholsky hat sich vor hundert Jahren einen „modernen Humoristen“ gewünscht. Er wolle zwar, schrieb er, der werten Dichtergeneration keine Fleißaufgaben stellen, aber: „Es wäre unser Humor, von unserer Zeit, in unserer Sprache, wenn sich einer aufmachte, das Individuum der Epoche zu zeichnen, das noch lange keines und das längst keins mehr ist.“ So eine moderne Humoristin ist Karen Duve; sie arbeitet inzwischen epochenübergreifend, aber immer mit derselben universellen Frage: was das denn für einer sei, dieser Mensch, der genetisch zu 98,7% mit dem Schimpansen übereinstimmt, und ungenetisch, aber tiefinnerlich zweifellos auch mit manch anderem Tier; einem Teddybären zum Beispiel.
Der stickige Innenraum eines Taxis, die laute Verklemmtheit in den Räumen eines westfälischen Schlösschens, das Gefühl wilder Freiheit auf dem Rücken eines Pferdes inmitten einer völlig unfreien Zeit, die verkarstete Lebensmüdigkeit am tiefen Grunde eines Herzens, das nie erfahren hat, was es denn heißt, zu lieben und geliebt zu werden: Karen Duve zeigt uns in jedem ihrer Bücher einen kleinen Ausschnitt Welt und macht dadurch soziale Realität greifbar. Ähnlich wie der von ihr übrigens sehr bewunderte Walter Kempowski recherchiert sie mit größter Gründlichkeit, wie eine Profilerin nimmt sie ihre Schauplätze, ihre Figuren und die Besonderheiten ihrer Zeit tiefengenau unter die Lupe. Wer wissen will, wie Menschen zu bestimmten Zeitpunkten gelebt haben oder ihr Leben ungelebt haben verstreichen lassen, wie sie hoch hinausstrebten und tief fielen, wie sie Macht missbraucht und Machtmissbrauch erlitten haben, muss Karen Duve lesen.
Denken wir z.B. einmal kurz über Thomas Müller nach, dieses grundgütige Wesen, in dessen Lebensmelodie sich wohl zuweilen eine leise Melancholie mischt, die aber doch getragen wird von der Zuversicht, dass alles irgendwie schon wieder werden wird. Thomas Müller ist, wenn auch manchmal hilflos, so doch tapfer und auf seine Art auch stark. Er ergreift uns durch seine Empfindsamkeit, in der wir vielleicht – in guten Momenten – uns selbst wiederfinden mögen. Diesen Thomas Müller machte Karen Duve 2003 erstmals öffentlich bekannt als Held des – von Petra Kolitsch übrigens wundervoll illustrierten – Kinderbuchs „Weihnachten mit Thomas Müller“, dem 2006 die Fortsetzung „Thomas Müller und der Zirkusbär“ folgte (das in diesen Tagen bei Galiani Berlin in einer Neuauflage erscheint, was ja schon mal ganz schön ist, aber liebend gern würde man auch ganz neue Folgen bei der Dichterin bestellen). Thomas Müller, der Stoffbär, „um die Ohren herum reichlich abgeliebt und abgewetzt“, geht beim vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit seiner Familie Wortmann im Karstadt mitten in der Hamburger Innenstadt verloren.
Marc Wortmann hatte Thomas Müller unter den Arm geklemmt, und irgendwann – vermutlich als Marc Wortmann die Turnschuhe mit dem integrierten Discolicht entdeckte – hatte er ihn fallen lassen und vergessen. So etwas kommt vor.
Einer der zentralen Sätze im Werk von Karen Duve: „So etwas kommt vor.“ Vorkommnisse dieser Art, die jedem zustoßen können, bilden den Kern ihres Erzählkosmos: das Vorkommnis des Verlorengehens, das Vorkommnis des Missachtetwerdens, das Vorkommnis der Liebe, das Vorkommnis der Intrige, das Vorkommnis der Rollenerwartung wie auch, gegebenenfalls, der Rollenverweigerung. So etwas kommt vor, und es betrifft uns alle. Alex, die Taxifahrerin, besucht einmal eine Party ihres Bruders, auf der sich lauter Jura-, BWL- und Medizinstudenten tummeln. Als sie erfahren, dass sie Taxi fährt, wollen sie von ihr Anekdötchen hören, zur Belustigung:
„Mir wurde klar, was sie in mir sahen: einen Freak, ein schrulliges Original, das Auskunft geben konnte über eine Welt, mit der ein angehender Rechtsanwalt sich erfreulicherweise erst beschäftigen musste, wenn es zum Gerichtstermin kam. Sie verstanden es nicht. Sie verstanden nicht, dass das, wovon ich erzählte, die Welt war, in der auch sie sich aufhielten. Dass es auch sie etwas anging.“
Alles, was Karen Duve erzählt, geht uns etwas an, aber auf ganz absichtslose Weise. Eigentlich ist sie ja die Literatin des Uneigentlichen: Eigentlich wollte sie nach ihrem Romandebüt, dem „Regenroman“, etwas ganz Kurzes machen, „140 Seiten, husch husch, wieder ein Buch draußen“. Tatsächlich – und zum Glück – wurde „Dies ist kein Liebeslied“ doppelt so lang. Eigentlich wollte sie nach ihren sehr kontrovers diskutierten Büchern „Warum die Sache schiefgeht“ und „Macht“ ein 120 Seiten-Büchlein zum Ausruhen schreiben, etwas Schönes aus der Zeit der Romantik. Tatsächlich versank sie in Büchern, Briefkompendien, Zeichnungen aus der Zeit, das Ergebnis war der 600 Seiten-Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“. Und eigentlich wollte sie danach nur ein kleines Geschenkebuch über Pferde schreiben – und schrieb stattdessen „Sisi“.
Karen Duve ist wahrscheinlich nicht Gott, aber vielleicht eine Art Schnupferich. Der Schnupferich aus den Mumin-Geschichten von Tove Jansson ist einer der literarischen Helden ihrer Kindheit; er verlässt jeden Herbst das Mumintal und wandert Richtung Süden, ganz allein. Einfach loswandern und schauen, was passiert. Bestimmt geht Karen Duve bald wieder auf Wanderschaft, ohne zu wissen, wann und womit sie zurückkehren wird. Wir aber werden sie, wie Mumin, seufzend erwarten und vorsichtig das Geschenk öffnen, das sie uns mitbringt: ein neues Buch, welch ein Glück!